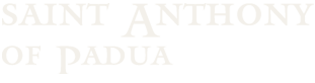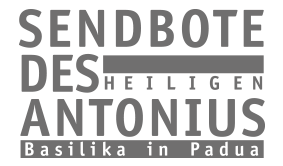Niemand kennt den Vater, nur der Sohn
Dem Sohn Gottes widmet das Glaubensbekenntnis sechs Artikel, die Hälfte von allen. Das Christentum ist das Bekenntnis zu einem Menschen, den das Konzil den vollkommenen Menschen nennt. Bei ihm als Meister sollen Menschen das Wichtigste lernen, das es zu lernen gibt: wie man anfängt, recht und gut Mensch zu sein, damit das Leben glückt. Jesus trägt ein abgründiges Geheimnis in sich. In kühnem Vorwärtsdrängen lässt das Glaubensbekenntnis die ganze Geschichte der Schöpfung hinter sich und steuert geradewegs auf diesen Höhepunkt der Schöpfung zu: Der Ausgangs- und Mittelpunkt christlichen Glaubens ist der Glaube an Christus (O. Cullmann).
| Verheißungsvoller Name. Der Name Jesus war in Israel keineswegs selten. Der Nachfolger des Mose und Führer ins verheißene Land hieß Josua. Es ist derselbe Name. |
| Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt Jesus (Joh 14,9). Für Jesus selbst wurde sein Name zum Programm seines Lebens und für die Menschen zur Verheißung. In der Kraft Gottes, des Schöpfers, richtete er die durch den Ungeist verwüstete Schöpfung wieder auf. Wie er damals heilend (vgl. Apg 10,38) zu den Menschen seines Volkes unterwegs war, so ist er seit der Vollendung seines Lebens unterwegs mit der ganzen Menschheit. Christen haben von Anfang an seinen Namen angerufen und heilig gehalten. Man stellte Häuser und Geräte unter seinen Schutz und schmückte sie mit den ersten drei (griechischen) Buchstaben des Namens Jesu: IHS. Wer ist dieser? Diese Frage, die sich häufig in den Evangelien findet, wurde nicht erst von den Christen nach Ostern gestellt, sondern schon von den ersten Augen- und Ohrenzeugen, die Jesus und seine machtvolle Verkündigung kennen lernten. Das tiefe Geheimnis seiner Person bleibt vor Ostern auch seinem engsten Jüngerkreis noch weitgehend verborgen. Doch sein machtvolles Auftreten und Lehren verweisen direkt darauf, dass er in einer einzigartigen Nähe zu Gott stehen muss. |
| Das ist mein Leib. Beim letzten Aufenthalt Jesu in Jerusalem anlässlich des Paschafestes kam es zur Konfrontation mit der religiösen Führerschaft. So musste Jesus realistisch mit der Möglichkeit eines gewaltsamen Todes rechnen. Diese Todesgewissheit mit dem Ausblick auf die Errettung durch den Vater hat sich beim letzten Abendmahl verdichtet (vgl. Mk 14,25). So konnte Jesus in den Deuteworten über Brot und Wein, das ist mein Leib........ das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird (Mk 14,23f.) seinen Leib anbieten und fürbittend für die Menschen hingeben, in der festen Zuversicht, dass Gott dieses Angebot annehmen und bestätigen werde. Das Wie der Verwirklichung der Gottesherrschaft, für die er bereit war zu sterben, legte er in Gottes Hand. Ostererfahrung. Seine Geschichte geht weiter. Er zeigte sich wiederholt seinen Jüngern als der in der Vollendung Lebende. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt; mit diesem Bekenntnis hat die Urkirche an die fünfzig Mal in den neutestamentlichen Schriften ihren Glauben ausgedrückt (z.B. Röm 10,9). Der Auferstandene sammelt seine Jünger aufs Neue, und rasch wächst die Gemeinde der Seinen über Jerusalem, Judäa und Samaria hinaus, bis an die Grenzen der Erde (Apg 1,8). |
| Christus, der Gesalbte. Aus Berufsbezeichnungen sind oft Namen geworden. Mit Christus war es nicht anders. Christus ist ein zweiter Eigenname für Jesus geworden. Was bedeutet dieser Name? In biblischer Zeit wurden Priester, Propheten und Könige für ihren Dienst an der Gemeinschaft mit Öl gesalbt. Die Kraft, mit der sie gestärkt werden sollten, war Gottes Heiliger Geist. Das Öl war Symbol der Kraft, Macht und Stärke. Die Erwartung eines Gesalbten, eines Idealkönigs aus Davids Geschlecht war zur Zeit Jesu besonders lebendig, da man von ihm die Befreiung vom Römerjoch und eine tief greifende religiöse Erneuerung erhoffte. Das hebräische Wort für Gesalbter ist Messias, das griechische Wort (mit lateinischer Endung) ist Christus. |
| Der Sohn Gottes. Zur Zeit Jesu wurde die Bezeichnung Sohn Gottes in einem sehr weiten Sinn gebraucht, da jeder Gerechte Sohn Gottes genannt werden konnte. Im Alten Testament trägt das Volk Israel den Würdenamen Sohn Gottes, weil es durch die Befreiung aus Ägypten von JHWH ins Leben gerufen worden war. In besonderer Weise gilt der König als Sohn Gottes, dessen Zeugung durch Gott bei seiner Thronbesteigung besungen wird (vgl. Ps 2,7; 110,1-3). Doch ist er nicht Sohn durch physische Abstammung von Gott – so verstanden sich die Könige der Antike –, sondern auf Grund des besonderen Amtes, das ihm von Gott übertragen wurde. – Diesen geläufigen Titel griffen die Christen nach Ostern auf. Der Evangelist Markus verkündet Jesus als den Sohn Gottes, der sich in machtvollen Taten offenbart (Mk 1,1), und doch unverstanden und noch unerkannt bleibt. Jesus selbst weiß sich als Sohn, wie niemand anderer Sohn ist: Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will (Mt 11,27). Das Geheimnis seiner Person besteht darin, dass Gott in einmaliger Weise sein Abba-Vater ist und er – in Entsprechung dazu – in einmaliger Weise Sohn. |
| Jesus, unser Herr. Im Bereich der griechischen Welt wurden mit den Titel Herr (Kyrios) vor allem die Götter angesprochen aber auch irdische Herrscher, die göttliche Ehre für sich beanspruchten. Für den biblischen Menschen ist JHWH allein der Herr Israels. Den Gottesnamen JHWH hat man in der griechischen Bibelübersetzung (2. Jh. v. Chr.) mit Kyrios wieder gegeben. So können wir ermessen, was die ersten Christen damit bekennen wollten, wenn sie Jesus ihren Herrn nannten. Es war ein Bekenntnis, das die Christen bald in Widerspruch zum römischen Kaiser bringen musste, der den Kyrios-Titel, und damit göttliche Verehrung für sich beanspruchte. |
| Endlich einer Martin Gutl |