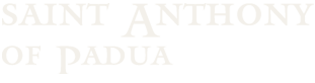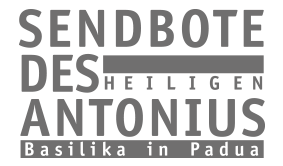Auf diplomatischem Parkett
Unser Autor blickt auf das Thema „Diplomatie“ und beginnt seinen Beitrag mit einem aktuellen Beispiel, das als Eklat zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der kriegsgeplagten Ukraine für gravierende Folgen gesorgt hat.
ine beispiellose Pressekonferenz, die sich am 28. Februar im Weißen Haus abspielte. US-Präsident Donald Trump, flankiert von seinem Vize J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio, empfing den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der befindet sich seit drei Jahren im Krieg. Seine Nation wurde zum Opfer eines von Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs durch die russische Armee. Er sucht weltweit nach Unterstützung um Hilfe, um den Angriff weiter abzuwehren und die Freiheit seines Volkes zu verteidigen. Das Oval Office ist an jenem letzten Februar-Tag voll mit Journalisten, darunter auch mehrere Youtuber, die erst seit Donald Trump Zugang zu solch exklusiven Treffen bekommen, während andere renommierte Nachrichtenagenturen außen vor bleiben müssen.
Schon bei der Begrüßung nach Ankunft Selenskyjs frotzelt der US-Präsident über die – aus drei Kriegsjahren hinlänglich bekannte – typische Kleidung des Ukrainers: Er verzichtet auf einen Anzug und trägt Pullover. Der ukrainische Präsident „überhört“ den Kommentar. Im Pressegespräch werden zahlreiche spezifische Fragen zur Ukraine und zum Kriegsverlauf, zum weiteren Engagement der USA und einem möglichen Rohstoffabkommen gestellt. Schließlich dann auch diese, völlig aus dem Zusammenhang: „Präsident Selenskyj, warum tragen Sie keinen Anzug?“ Nach und nach gerät das Gespräch aus dem Ruder, wird wilder und ungeordneter. Der US-Vize wirft Präsident Selenskyj mangelnden Respekt und fehlende Dankbarkeit vor. Und Donald Trump wird zunehmend rüder gegenüber dem Vertreter der Ukraine, den er zuvor schon als Diktator bezeichnet hatte, und der offensichtlich zunehmend Mühe hat, die Fassung zu bewahren. Schließlich beendet der Hausherr das Schauspiel: „Entweder Sie gehen einen Deal ein oder wir sind raus. (...) Sie verhalten sich überhaupt nicht dankbar. Und das ist nicht nett. Ich bin ehrlich, das ist nicht nett. In Ordnung, ich denke, wir haben genug gesehen. Was meinen Sie? Großes Fernsehen. Das muss ich sagen.“
Eklat mit Breitenwirkung
Die meisten Medien weltweit sind sich in der Berichterstattung einig: ein diplomatisches Desaster. Ein Gau auf diplomatischem Parkett. Wurde dem ukrainischen Präsidenten bewusst eine Falle gestellt? Hat er sich provozieren lassen und lief der amerikanischen Führung ins Messer? War es zu früh für ein solches Treffen? Hätte man nicht erst noch weiter unter Ausschluss der medialen Öffentlichkeit Differenzen beilegen müssen? Oder fehlt dem ukrainischen Präsidenten tatsächlich der Wille, die Situation realistisch einzuschätzen? – Die Auswirkungen dieses Eklats waren und sind enorm. Hat die Diplomatie versagt?
Die hohe Kunst des Miteinanders
Das Politiklexikon von Klaus Schubert und Martina Klein definiert „Diplomatie“ auführlich: „Diplomatie bezeichnet die professionelle Tätigkeit, die (ökonomischen, kulturellen, politischen, militärischen) Interessen eines Staates bei einem anderen Staat zu vertreten, die dazu notwendigen Vorarbeiten zu leisten und (außen-)politische Entscheidungen zu treffen sowie Informationen über das Ausland zu sammeln und Reaktionen aus dem Ausland an den (eigenen) Staat zu vermitteln. Der Begriff Diplomatie bezieht sich auch auf den Verkehr zwischen Staaten und internationalen Organisationen sowie zwischen den internationalen Organisationen selbst. Diplomaten bzw. Diplomatinnen sind (i. d. R.) Beamte des Außenministeriums, die über eine spezielle Ausbildung für den diplomatischen Dienst und die diplomatische Tätigkeit verfügen. Sie genießen im Empfangsstaat einen besonderen Schutz (Immunität, insb. vor polizeilicher oder gerichtlicher Verfolgung). Die Gesamtheit der Diplomaten und die ständige Behörde eines Entsendestaates in anderen Staaten werden als diplomatische Mission (diplomatische Vertretung) bezeichnet. Bestehende
diplomatische Beziehungen zwischen Staaten verweisen auf den prinzipiellen Willen zur friedlichen Konfliktlösung und zum gegenseitigen Interessenausgleich. Bei Zuspitzung der Interessenunterschiede kann der jeweilige Missionschef zurückbeordert werden; die Abberufung des obersten Repräsentanten eines Staates bedeutet i. d. R. den Abbruch der diplomatischen Beziehungen.“
Diplomatie ist damit die hohe Kunst und Praxis der Verhandlung zwischen Staaten oder anderen politischen Akteuren, um internationale Beziehungen friedlich zu gestalten. Dazu gehören eine fundierte Ausbildung, ein stattlicher Apparat an Mitarbeitenden und Strukturen sowie ein fein austariertes System an Beziehungen und ein über Jahrzehnte und länger erprobtes Miteinander unter bestimmten Spielregeln.
Geschichtliche Entwicklung
Die Fähigkeit zur Diplomatie – beziehungsweise die Einsicht in deren Notwendigkeit – haben die Völker dieser Erde erst nach und nach entwickelt. Zwar gab es diplomatische Anfänge schon vor Jahrtausenden bei den ersten Stadtstaaten, später dann auch zwischen dem Papst und dem byzantinischen Kaiser, die ersten Botschaften im modernen Sinn wurden jedoch erst im 13. Jahrhundert gegründet. Hier waren die italienischen Stadtstaaten Vorreiter. Der (damalige) Staat Mailand war es dann auch, der 1455 den ersten Botschafter an den französischen Hof entsandte, gleichzeitig aber einen französischen Vertreter auf eigenem Territorium aus Furcht vor Spionage und Einmischung ablehnte. Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts sind stabile gegenseitige Missionen unter den führenden Nationen Europas aber etabliert. Weitere 200 Jahre wird es dauern, bis sich dieses System nach Osteuropa und Russland ausdehnt – dann aber größtenteils unterbrochen von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress im Jahr 1815. Die Vormachtstellung Europas und die Kolonialisierung sorgen schließlich dafür, dass sich das europäische System der Diplomatie über die Welt ausdehnt. – Der Blick auf die Bundesrepublik Deutschland zeigt, welch enormes Netzwerk unterhalten wird, um mit anderen Staaten in ständigem Kontakt zu sein: Die BRD unterhält fast 160 Botschaften und über 60 Generalkonsulate. Für die österreichische Bundeshauptstadt Wien verrät die Statistik: Etwa 130 diplomatische Vertretungen sind hier angesiedelt, mehr als 40 internationale Organisationen, die sich für Frieden und Sicherheit einsetzen, haben hier ihren Standort, etwa 3.800 Diplomaten und 6.000 internationale Beamte arbeiten in der Donaumetropole und machen Wien zu einem diplomatischen „Hotspot“.
Viele Nationen in einem Boot
Eine zentrale Rolle in der Diplomatie spielen internationale Organisationen. Sie schaffen den Rahmen für multilaterale Verhandlungen und Kooperationen zwischen mehreren Staaten. Die 1945 – nach dem Schrecken des 2. Weltkriegs – gegründete UNO (Vereinte Nationen) ist dabei die wichtigste globale Institution für diplomatische Konfliktlösung, Friedenssicherung und humanitäre Hilfe. Auch wenn sie als dringend reformbedürftig gilt, dient die Generalversammlung als Plattform für wegweisende diplomatische Debatten, und der Sicherheitsrat entscheidet über internationale Maßnahmen wie Resolutionen, Sanktionen und Friedensmissionen. Die NATO wiederum hat als Verteidigungsbündnis eine sicherheitspolitische Dimension: Diplomatie innerhalb der NATO bedeutet vor allem Koordination gemeinsamer Strategien und die Stärkung kollektiver Sicherheit. Die regelmäßige Kritik von Donald Trump am Bündnis macht Schwächen einst unverbrüchlich geltender Zusagen offenbar, sorgt aber offensichtlich auch dafür, dass die Mitgliedsstaaten ihren Investitionsverpflichtungen für den Verteidigungsfall besser nachkommen.
Für den europäischen Bereich ist die Europäische Union das herausragende Beispiel einer besonders engen Form multilateraler Diplomatie. Viele für lange Zeit nationalstaatlich ausgeübte Kompetenzen wurden nach Brüssel abgegeben; die Mitgliedsstaaten sind in vielen Bereichen eng verzahnt. Neben der Außen- und Sicherheitspolitik betreibt die EU auch Wirtschaftsdiplomatie, etwa durch Handelsabkommen oder Sanktionspolitik. Im Gegensatz dazu sind die G7 und G20 informelle Foren der größten Wirtschaftsmächte der Welt, die durch diplomatische Treffen und Gipfel gemeinsame wirtschaftliche und politische Strategien entwickeln. In mühsamer Kleinarbeit und mit viel Abstimmung hinter den Kulissen werden Gipfeltreffen vorbereitet, Positionspapiere abgestimmt und Kompromisse so weit gedehnt, dass möglichst niemand sein Gesicht verliert und in der Sache dennoch Fortschritte zum allgemeinen Wohl erzielt werden können.
Erfolge und Misserfolge
Der Blick in die Geschichte zeigt, dass die Diplomatie ein mächtiges Instrument zur Konfliktlösung sein kann – aber auch ihre Grenzen hat, wenn Verhandlungen nicht mit realpolitischer Macht oder ernsthaftem politischen Willen untermauert sind. Die diplomatische Verständigung zwischen den USA, der Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien ermöglichte nach dem Ende des Kalten Krieges im Jahr 1989/90 die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands. Jahrzehnte zuvor konnte dank intensiver Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion während der Kuba-Krise 1962 ein Atomkrieg wohl in letzter Sekunde verhindert werden.
Der Irak-Krieg 2003 hingegen ist ein prominentes Beispiel für das Scheitern diplomatischer Bemühungen. Trotz intensiver Diskussionen im UN-Sicherheitsrat entschieden sich die USA und Großbritannien für eine militärische Intervention, die auf der Behauptung basierte, der Irak besitze Massenvernichtungswaffen – eine Behauptung, die sich später als falsch herausstellte. Die UNO konnte den Krieg nicht verhindern, und die Invasion führte nicht nur zur Destabilisierung des Iraks, sondern auch zu langanhaltenden Konflikten in der gesamten Region. 2014 konnte die Annexion der Krim durch Russland nicht verhindert werden, obwohl westliche Staaten durch Verhandlungen und Sanktionen versuchten, eine Eskalation und die Verletzung der ukrainischen Souveränität zu verhindern. Weder die diplomatischen Gespräche noch internationale Strafmaßnahmen konnten Moskau zum Einlenken bewegen, und der Konflikt in der Ostukraine hält bis heute an. Auch der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan im Jahr 2021 offenbart die Grenzen diplomatischer Verhandlungen. Die USA hatten über Jahre hinweg Gespräche mit den Taliban geführt, um eine geordnete Übergabe der Macht zu ermöglichen. Doch nach dem endgültigen Abzug der Truppen übernahmen die Taliban das Land in rasantem Tempo, ohne dass die afghanische Regierung Widerstand leisten konnte. Das Ergebnis war ein chaotischer Rückzug westlicher Staaten, die dramatische Flucht vieler Afghanen und eine humanitäre Krise, die hätte verhindert werden können, wenn die Verhandlungen nachhaltiger und mit besserer Absicherung geführt worden wären.
Das weltweit friedliche Miteinander bleibt damit eine permanente Herausforderung.
Sonderfall Vatikan
Die Diplomatie des Vatikans unterscheidet sich in mehreren Aspekten von der klassischen staatlichen Diplomatie. Während gewöhnliche Staaten ihre Interessen oft wirtschaftlich, militärisch oder geopolitisch definieren, verfolgt der Vatikan primär moralische, ethische und religiöse Ziele. Ein besonderer Unterschied liegt dann auch darin, dass der Vatikan keine wirtschaftlichen oder militärischen Machtmittel besitzt, sondern allein auf seine moralische Autorität setzen kann. Der Heilige Stuhl unterhält dazu eines der ältesten und weitreichendsten diplomatischen Netzwerke der Welt: Er pflegt offizielle diplomatische Beziehungen zu über 180 Staaten und hat Beobachterstatus in internationalen Organisationen wie der UNO. Die diplomatischen Vertreter des Vatikans sind die Nuntien, die als päpstliche Botschafter fungieren und meist eine doppelte Rolle spielen: Sie vertreten den Heiligen Stuhl diplomatisch, sind aber gleichzeitig Vermittler zwischen dem Vatikan und der lokalen katholischen Kirche eines Landes. An der Päpstlichen Diplomatenakademie in Rom beginnen jährlich etwa 30 Geistliche ihre Ausbildung. Sie promovieren in der Regel in kanonischem Recht und absolvieren parallel die Ausbildung an der Diplomatenakademie. Ein Drittel von ihnen wird später aus den vatikanischen Nuntiaturen heraus die diplomatischen Beziehungen des Vatikans pflegen. Auch stellen sie sich damit in den Dienst zahlreicher Diplomatinnen und Diplomaten auf der ganzen Welt, die zwar immer auch die Eigeninteressen der jeweiligen Länder vertreten, die sich aber darüber hinaus darum bemühen, ein gedeihliches Miteinander der Weltgemeinschaft zu ermöglichen.