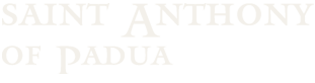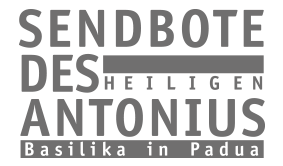Bricht die Gesellschaft auseinander?
Immer mehr Menschen machen sich Sorgen, dass die Gesellschaft sich entzweit. Mit Polemik, Polarisierung und Spaltung beschäftigt sich unser Autor im Thema des Monats.
Von immer mehr Polemik, von Polarisierung und Spaltung, von Scheren, die auseinander gehen, von Gefällen zwischen Nord und Süd oder Differenzen zwischen Ost und West ist in den letzten Jahren zunehmend häufiger die Rede. Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser stellen in ihrer Studie „Triggerpunkte“ gleich eingangs fest: „Auf politischen Podien, in Talkshows wie auch in den sozialen Medien verbreiten sich Polarisierungsdiagnosen geradezu inflationär. Auch für den Printjournalismus lässt sich ein sprunghafter Anstieg des Vokabulars von Polarisierung und Spaltung verzeichnen: So kann man anhand des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache ermitteln, wie häufig bestimmte Begriffe in großen deutschsprachigen Tages- und Wochenzeitungen vorkommen. (…) Der Formel ‚Spaltung der Gesellschaft‘ sowie Wörtern, die mit ‚polaris-‘ beginnen (etwa ‚polarisiert‘, ‚polarisierend‘ oder ‚Polarisierung‘), wird im Verlauf der Jahrzehnte immer größere Prominenz zuteil. Spaltungsdiagnosen schießen vor allem in den letzten zehn Jahren in die Höhe, die Häufigkeit des Polarisierungsbegriffes nimmt schon seit Längerem stetig zu.“
Alle sind betroffen
Ob die Welt dabei wirklich auseinanderdriftet, ist eine soziologisch komplexe Frage mit höchst unterschiedlichen Antworten, auch im Blick auf den jeweiligen Kulturraum, der untersucht wird. Spaltung und Polarisierung haben in den Vereinigten Staaten von Amerika beispielsweise ganz andere Ausmaße erreicht als in den allermeisten Ländern Europas. Doch mit Sicherheit darf man annehmen: Polemisierung und Polarisierung gehen weder spurlos am individuellen Menschen noch an der Gesellschaft mit ihren vielen Teilbereichen vorbei.
Das hat wesentlich mit diesem Phänomen zu tun: Je komplexer die Welt sich zeigt, desto einfacher haben es einfache Antworten. Bleibt das kritische Hinterfragen aus, setzt sich durch, wer lauter und pointierter schreit. Dann wird Polemik zum Strudel, der kaum noch zu stoppen ist.
Paradebeispiel Donald Trump
In der jüngeren Geschichte hat der im November 2024 wiedergewählte und vor kurzem vereidigte US-Präsident Donald Trump die politische und gesellschaftliche Debatte geprägt wie kaum ein anderer, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch darüber hinaus. In einem fast nicht zu übertreffenden Simplizismus teilt er die Welt in „gut“ und „böse“, in solche, mit denen man einen „Deal“ abschließen kann, und solche, die man bekämpfen muss – und macht sich damit ein Prinzip zu eigen, das populistische Menschen aller Couleur eint, nämlich „das Prinzip des ‚Wir-hier-unten gegen Die-da-oben“, wie es der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky zusammenfasst. Sie „nehmen für sich in Anspruch, für das ‚wahre Volk‘ zu sprechen.“ Dabei gilt einschränkend: „Sie meinen damit aber nicht jedermann oder alle Bürger. Sie meinen nicht das Staatsvolk – so wie es demokratische Verfassungen tun –, sondern eine bestimmte Gruppe, die in den Stand des ‚wahren‘ Volkes erhoben wird. Indem sie sich selbst zum Sprecher und ihre Agenda zum Willen des Volkes machen, geben sie auch vor, wer das Volk ist und was es will.“
Donald Trumps wirksamste rhetorische Waffe, um politische Gegner und Konkurrentinnen in diesem „Spiel“ zu diskreditieren: Spitznamen. Seine einstmalige Mitbewerberin um das Präsidentenamt, Hillary Clinton, belegte er im erfolgreichen Wahlkampf mit dem Spitznamen „Crooked Hillary“. Sein Nachfolger, Präsident Joe Biden, wurde zu „Sleepy Joe“. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un verniedlichte er als „The Little Rocket Man“ und seine schließlich unterlegene Gegnerin im Präsidentenwahlkampf 2024, Kamala Harris, diffamierte er als „dumm wie ein Stein“ und „Crazy Kamala“. Im Internet werden eigene Listen geführt, wen Donald Trump mit welchen Spitznamen belegt hat. Über 200 Einträge zeigen, wie gern und wirkungsvoll er diese Taktik anwendet. Das Magazin Columbia Journalism Review, herausgegeben von der Columbia University Graduate School of Journalism, zeigt auf, dass Donald Trumps Spitznamen eine „enorme sprachliche Gewalt“ innenwohnt. Er „präsentiert in einer komplizierten Welt eine leicht verdauliche moralische Einteilung.“ Wenn seine Strategie der Beleidigung „gut eingesetzt wird, kann sie bei den
Adressaten mit unauslöschlicher Beharrlichkeit kleben bleiben, und Präsidentschaftskandidaturen, den Ruf und die Karriere insgesamt ruinieren.“ Man selbst behält die Oberhand, der oder die jeweils Andere wird ins Abseits gespielt.
Der Ton wird rauer
Polemik prägt aber längst nicht nur Politik und Gesellschaft jenseits des Atlantiks. Im Deutschen Bundestag ging es in den letzten Jahrzehnten rhetorisch immer wieder einmal heftig zur Sache. Eine gelegentlich pointierte Wortwahl gehört durchaus zum politischen Geschäft. Doch in der laufenden Wahlperiode (2021-2025) wurden stolze 110 Ordnungsrufe vom Bundestagspräsidium erteilt. Natürlich, das Parlament hat aktuell eine Rekordabgeordnetenzahl von 733. Doch von 2017 bis 2021 waren es mit 709 Frauen und Männern im Bundestag unwesentlich weniger, und sie brachten es auf „nur“ 49 Ordnungsrufe. Bei einem Blick in die frühere Vergangenheit wird die Entwicklung noch deutlicher: zwei Ordnungsrufe zwischen 2013 und 2017, und im 17. Bundestag die vier Jahre zuvor gar nur ein einziger. Mit einem Anteil von 66% der Ordnungsrufe für Entgleisungen wie „Kindermörder“, „migrantische Langfinger“ oder „feuchte Träume einer Extremistin“ ist die Alternative für Deutschland Spitzenreiterin: „Debatten und einzelne Redner werden gezielt durch Zwischenrufe, lautstarke Unruhen und Beleidigungen behindert. Eigene Debattenbeiträge werden dazu genutzt, das parlamentarische System und die ‚Altparteien‘ systematisch öffentlich zu diskreditieren“, analysiert Andreas Schulz, Generalsekretär der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Für immerhin 1/3 der Ordnungsrufe sind aber Mitglieder der anderen Parteien verantwortlich. Gut möglich, dass man sich gegenseitig hochschaukelt und ein bestimmtes, eigentlich unanständiges Verhalten schrittweise salonfähig geworden ist.
Populismus zieht Kreise
Und schließlich: Was für die große Welt gilt, gilt oft spiegelbildlich für die kleine Welt, in welcher sich der ganz normale Mensch Tag für Tag bewegt. Ton und Stil verändern sich und prägen damit unsere Wirklichkeit. Wie die vermeintlichen Vorbilder miteinander umgehen, hat Auswirkungen darauf, wie „Du und ich“ einander behandeln. Dass zu den Synonymen für „polemisch“ Worte zählen wie bissig, boshaft, gehässig, streitsüchtig, hasserfüllt, bösartig, streitbar, ausfallend, niederträchtig, unversöhnlich, infam, unfair, ungerecht, diffamierend, beleidigend oder verleumdend, spricht Bände. Wen wundert’s, wenn aus Polemik schließlich Polarisierung und Spaltung resultiert? Die Prämisse des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß scheint sich mehr und mehr durchzusetzen: „Everbody’s darling is everybody’s Depp!“ Wenn das zur Maxime des Handelns geworden ist, dann gibt es kaum noch Hemmnisse. Populistisches Gehabe schwillt immer weiter an.
Gruppen und Meinungen entfernen sich zunehmend voneinander und die Toleranz für die Gegenseite nimmt kontinuierlich ab. Schließlich kommt es zum Riss, zur Spaltung.
Streitthemen mit Konfliktpotential
Themen, bei denen die Meinungen dabei augenblicklich besonders auseinandergehen: Migration, sowie Klima und Umweltschutz. Unterschiedliche Meinungen zur Aufnahme von Geflüchteten, zur Einwanderungspolitik und zu kulturellen Werten führen zu starken Spannungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Während einige Menschen eine offene und multikulturelle Gesellschaft befürworten, lehnen andere diese Entwicklung ab und fürchten den Verlust traditioneller Werte und kultureller Identität. Auswirkungen des nur noch von wenigen geleugneten Klimawandels sind immer häufiger zu spüren: Temperaturverschiebungen, Starkregenereignisse, extreme Hitzewellen und ansteigender Meeresspiegel. Niemand kommt mehr an diesen Tatsachen vorbei. Doch was tun, um den von Menschen gemachten Anteil am Klimawandel in den Griff zu bekommen? Daran scheiden sich die Geister, wie hitzige, nahezu dogmatische Debatten um E-Autos oder Verbrenner, Atomenergie oder erneuerbare Energiequellen zeigen.
Zwei konträre Lager?
Die Existenz solcher Streitthemen ist unübersehbar und wird von niemandem bestritten. Dass daraus aber – im europäischen Raum – eine Spaltung der Gesellschaft resultiert, darüber herrscht keine Einigkeit. In ihrem Buch „Die gespaltene Gesellschaft“ stellen Jürgen Kaube, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und André Kieserling, Professor für Allgemeine Soziologie in Bielefeld, fest: „Es wird (…) durch starke Konflikte zumindest keine Gesellschaft gespalten, denn wir unterhalten gar kein starkes gemeinschaftliches Verhältnis zu den allermeisten unserer Mitbürger.“ Sie gehen davon aus, dass die moderne Gesellschaft in sich zu vielfältig und inhomogen ist, dass sie intern so mobil und an Abweichung und Eigensinn gewöhnt ist, dass der vorausgehende Zusammenhalt letztlich sehr begrenzt ist, damit aber auch das Potenzial, gespalten zu werden. Menschen stehen zueinander in wechselnden Allianzen. Und es gibt „nicht nur eine Linie der Differenzierung, sondern mehrere“, was eine Spaltung der Gesellschaft in nur zwei Teile, in rechts und links, oben und unten, reich oder arm, Ost und West wenig plausibel erscheinen lässt. Gleichwohl gibt es mit dem Blick auf die Vereinigten Staaten ein anschauliches Beispiel, wie sich eine Gesellschaft polar auseinanderentwickelt: Anhänger und Wählerinnen von Republikanern und Demokraten stehen politisch unversöhnt nebeneinander und selbst im Privatleben geht man sich tunlichst aus dem Weg. Für die Diagnose in Deutschland nutzen Kaube und Kieserling schließlich aber – in Abgrenzung zur starken US-amerikanischen Polarität – den Begriff der „Versäulung“, ebenfalls eine Spaltungsform, bei der es jedoch weit mehr „Lager“ gibt als nur zwei.
Abgelöster Universalismus
Dass Spaltungsphänomene obendrein kein rein modernes Phänomen sind, zeigt der in München geborene und in den USA lehrende Politikwissenschaftler Yascha Mounk auf. In seinem Buch „Im Zeitalter der Identität“ steigt er tief in die Weltgeschichte ein und zählt auf: „Christliche Kreuzfahrer bekehrten Abertausende mit dem Schwert und töteten jene, die sich nicht bekehren lassen wollten. Amerikanische Kolonisten führten Ausrottungskriege gegen die Ureinwohner und betrieben ein besonders brutales System der Sklaverei. Auf dem indischen Subkontinent wies ein rigides Kastensystem mehr als 1000 Jahre lang einem riesigen Teil der Bevölkerung den Status von Unberührbaren zu. In China nahmen Kaiser den Tod von Hunderttausenden Untertanen in Kauf, um ihre berühmte Mauer zu bauen. In Afrika führten die Mitglieder rivalisierender Stämme jahrhundertelang Krieg gegeneinander.“
Konflikte und Spaltungen prägten also wohl schon immer die Menschheitsgeschichte auf allen Kontinenten. Eine große Gefahr sieht Mounk nun jedoch darin, dass der traditionelle Universalismus, der Menschen miteinander verbinden will, weitgehend abgelöst wurde von einer neuen Identitätspolitik. Die nimmt weniger den einzelnen Menschen in den Blick als vielmehr Gruppen, also beispielsweise Homosexuelle, Transgender, People of Color,… Diese, so der Ansatz der neuen Identitätspolitik, sollen innerhalb ihrer Identitätsgruppe für ihre kollektive Befreiung kämpfen. Die starke Gruppenidentität macht es dann aber schwerer, „Allianzen zu schmieden, die über die eigene Identitätsgruppe hinausgehen – Allianzen, die wir brauchen, um auf Dauer Stabilität, Solidarität und soziale Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten.“ Der alleinige Fokus liegt auf der eigenen Gruppe. So wertvoll und wichtig das Eintreten für die Rechte von einzelnen Gruppen ist: In ihrer gesteigerten Form ist diese Art der Identitätspolitik nicht mehr bereit, abweichende Meinungen zu akzeptieren. Sie werden bald nicht mehr nur als sachlich falsch, sondern obendrein als moralisch verwerflich disqualifiziert. Gesellschaftliche Debatten um den „alten weißen Mann“ oder die wiederkehrenden Klagen darüber, dass man heute quasi nichts mehr unbedacht sagen dürfe, ohne einen „Shitstorm“ auszulösen, sind plastische Beispiele dieser Analyse, die zu (polemischen) Verhärtungen auf allen Seiten führen.
Vorsicht, Falle!
Die Politikwissenschaftlerin, Soziologin und Gründerin des John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung, Ulrike Ackermann, fasst zusammen: „Die Polarisierungen in diesen Debatten sind flankiert von einem wachsenden Moralisierungsdruck, der ein umfassendes Argumentieren, das heißt eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Krisen und Herausforderungen ohne Denkverbote und ideologische Scheuklappen immer schwieriger macht. Deshalb schnappt die Polarisierungsfalle zu, und sie greift so erbarmungslos, weil die Kontrahenten sich in ihrem Wunsch nach Eindeutigkeit, Reinheit der Position und beim Leugnen von Ambivalenzen gegenseitig noch befeuern.“
Weil also Extrempositionen immer stärker werden und schnellere Verbreitung finden, kommt Yascha Mounk zum Schluss: „Für den Eindruck einer radikalen Spaltung der Gesellschaft gibt es gute Gründe. Eine kleine Anzahl von Personen hat tatsächlich extreme Ansichten zu fast jedem umstrittenen Thema. Und so wie die Politik und die Medien funktionieren, erhalten diese Stimmen eine unverhältnismäßig große Plattform.“ Extremisten sind auf dem Vormarsch. In der „schweigenden Mehrheit“, die er für „erstaunlich vernünftig und divers“ hält, sieht er allerdings die Hoffnung, nicht noch weiter in die „Identitätsfalle“ zu tappen und weitere Spaltungsprozesse zu befeuern.
Ob nun klassische Spaltung in zwei Hälften, Versäulung oder „zerklüftete Konfliktlandschaft“, wie die Autoren von „Triggerpunkte“ resümieren, oder ob die Spaltungstendenzen mehr „gefühlt“ sind als reale Tatsachen: Es gilt, das Unbehagen der Menschen damit ernst zu nehmen, mögliche Konsequenzen eines immer weiteren Auseinanderdriftens klar im Blick zu haben und bereits im Kleinen und Alltäglichen wirksam gegenzusteuern. Möge die schweigende Mehrheit ihre Stimme erheben!